|
|
|
|
|
Merzdorf
entstand um 1200 und ist als Waldhufendorf angelegt. Das Dorf selbst
bestand nicht nur aus Bauerngütern, sondern war auch von einfachen Häuslern
und Gärtnern bewohnt. Letztere lebten nicht nur von der
Landwirtschaft, sondern auch vom Handwerk, der Arbeit in den Stein-
und Kalkbrüchen sowie Lehmgruben.
|
|
|
|

|
Merzdorf und
Biensdorf liegen nördlich von Frankenberg (Autobahnauffahrt) und gehören zur
Gemeinde Lichtenau.
Diese Karte können
Sie mit einem Mausklick vergrößern.
|
|
Neben der Landwirtschaft
wurde hier schon seit langem Lehm zur Herstellung von gebrannten und
ungebrannten Ziegelsteinen abgebaut. Unmittelbar an den Ort grenzen auch
zwei Sandgruben, die noch bis in das 20. Jahrhundert betrieben wurden.
Unweit der Sandgruben wurde schon seit dem Mittelalter Kalkstein untertage
gewonnen und mit Steinkohle (!) zu Kalk gebrannt. Dieser kam im Baugewerbe
und der Landwirtschaft zum Einsatz.
|
Die Suche nach Steinkohle,
den Flözen der Ebersdorfer Formationen, wurde immer wieder versucht. Westlich
des Dorfes, in Nähe Lichtenauer Fluren wurde vor 1900 ein Schacht zur Suche
nach Steinkohle angelegt. Die genaue Lage des Schachtes ist bis zum heutigen
Tag nicht näher bekannt. Jedoch soll er 80 m Teufe erreicht haben, ohne abbauwürdige
Flöze anzutreffen.
|
|
Bergbau wurde auf den Fluren
von Merzdorf zur Gewinnung von Metallen vermutlich schon in Ur- und Frühgeschichtlicher
Zeit betrieben. Eindeutige Belege konnten bei sporadischen Untersuchungen
von Archäologen erbracht werden. Leider wurden die Spuren dieses Bergbaus
im wesentlichen schon vor über 200 Jahren beseitigt und die Flächen der
Landwirtschaft zugeführt.
|
Dennoch gibt es neben einigen
schriftlichen Überlieferungen auch Ansatzpunkte zur Geländearbeit. Auf den
Fluren von Merzdorf, am Gehänge zur Zschopau bis nach Biensdorf lag ein nicht
zusammenhängendes Grubenfeld. Das Gelände ist nicht allzu steil und eignete
sich auch für die Landwirtschaft. Ein Grund für den Beginn der Einebnung
dieser Bergbauflächen zwischen 1730 und 1745.
|
|
|

|
Am Ortsausgang von
Merzdorf gleich hinter der Gasstation fällt eine kleine bewaldete Schlucht
auf. Hier fanden sich bis vor wenigen Jahrzehnten noch bergbauliche Spuren in
Form eines Stollnmundloches und diverser Halden. Durch die Verkippung von Müll
sind ganze Teile der Schlucht nebst Halde und Mundloch verfüllt worden. Heute
erinnert nur noch der verrohrte Wasseraustritt zur Speisung eines Swimmingpools
daran. In einer alten Chronik wird das Feld links neben der Schlucht als „Kramrich“
bezeichnet. Es soll sich dabei um einen alten Marktflecken aus der Bergbauzeit
handeln (?).
|
|
|

|
Der obere Teil
der Schlucht diente jahrzehntelange als illegale Müllkippe, nachräglich
wurde der ganze Unrat noch mit Lesesteinen von den umliegenden Feldern und
auch Bauschutt überkippt. Von bergbaulichen Spuren ist hier nichts mehr zu
sehen!
|
|
|

|
Stellenweise ragt
heute das Grundgebirge an einigen Stellen im unteren Teil aus der Überschüttung
hervor. In früheren Zeiten war diese Schlucht größer und die offenen
Felsformationen wiesen den Bergleuten den Weg zum Erz.
|
|
|
Das Gehänge zur Zschopau wurde
auch als Merzdorfer Gebirge bezeichnet. Das Pingen- und Haldenfeld nahm seinen
Anfang am Merzdorfer Berg gegenüber Frankenberg. Hier weisen heute Flurnamen
wie „Am Steinsberg“ auf eine bestimmte Geländebeschaffenheit hin. Dennoch
ist die Lage des Grubenfeldes nicht eindeutig nachweisbar. Die Angabe „Am
Merzdorfer Gebirge gegen Frankenberg über“ ist sehr ungenau und auch irreführend!
Selbst die Verlegung einer Gasleitung 1998 brachte keine Funde im Aushub, die
auf ein Bergbaugebiet schließen ließen.
Alle weiteren in Frage
kommenden Flächen, wie der „Steinsberg“ selbst, sind noch nicht praktisch
untersucht wurden. Jedoch finden sich in vorhandenen Bergakten Angaben zu einem
Grubenbetrieb der im Quartal Crucis 1736 aufgenommen wurde.
|
Der Lehnträger, Johann
Heinrich Müller, betrieb mit einem Steiger und einem Bergknecht diesen
Grubenbau unter dem Namen „Unverhofft Glück Fundgrube samt Johannes Stolln“,
sowie zwei oberer Maaße. Der Betrieb erfolgte auf einen Stolln den man in
diesem Quartal sechs Lachter ins Gebirge getrieben hatte. Auch erhielt Müller
auf Anfrage beim zuständigen Bergamt Marienberg eine Abschrift eines
Aufstandes der Vorfahren, welcher im Königlichen Gegenbuch (für diese
Revierabteilung heute nicht mehr existent) vorhanden war.
Der Gang, auf dem man den
Stolln vortrieb, strich als stehender Gang mit einer Mächtigkeit von einem
Querfinger und führte etwas roten Spat (Schwerspat). Anfang des Jahres 1737 gründete
Müller eine Gewerkschaft. Im Quartal Crucis selben Jahres überfuhr der Stolln
einen Spatgang, der Stunde 7 strich, zwei Querfinger mächtig war und etwas
Quarz führte. Der „Wünschelruthengänger“ fand diesen Gang allerdings
nicht, seine Vorgabe lag noch 9 Lachter vom jetzigen Ort entfernt. Diesen
Spatgang fuhr der Steiger Johann Christoph Koch mit zwei Bergknechten weiter
auf. Der Vortrieb erfolgte als verdingte Arbeit. Die Gewerkschaft war zu diesem
Zeitpunkt nicht komplett. Den Kux hatte das Bergamt auf 12gl (12 Groschen) Zubuße
festgelegt. Im Quartal Trinitatis 1738 stand die Auffahrung bei 34 Lachter
Entfernung vom Stollnmundloch.
|
|
|
|
Dabei traf man 18 Lachter vom
Mundloch einen Morgengang, der noch 16 Lachter aufgefahren wurde. Der
Morgengang stand mit einer Mächtigkeit von 2 - 3 Querfinger von „Kupffrig
Schieffriger Bergart“ im weichen Tonschiefer an. Mindestens bis zum Quartal
Trinitatis 1740 setzte die Gewerkschaft den Grubenbetrieb fort und erreichte
eine Länge von 41 Lachtern.
Später finden sich keine
Nachrichten mehr in den Aufständen (Grubenberichten) des Marienberger
Bergamtes. Der fahrende Berggeschworene Christian Täuscher bemerkte in seinen
Protokollen noch, dass in der Nähe des Stollns ein ansehnliches Pingen- und
Haldenfeld lag. Vermutlich kam der Grubenbetrieb nur zustande, weil bei den
Rekultivierungsarbeiten erzhaltige Gangstücke gefunden wurden. In
heimatkundlichen Überlieferungen wird in Nähe des Grubenfeldes ein alter
Marktflecken mit den Namen „Kramrich“ genannt.
|
|
Ein weiteres Pingen- und
Haldenfeld lag unmittelbar am Ortsausgang von Merzdorf, rechts der
Ortsverbindungsstraße nach Biensdorf, im Bereich einer kleinen Schlucht (auch
tiefer Grund genannt) die an der jetzigen Gasstation ihren Anfang nimmt.
|
Diese Schlucht diente bis
in die 1980er Jahre als Schuttplatz und wurde auch jahrzehntelang mit
Feldsteinen von der örtlichen LPG verfüllt. Oberhalb des unteren
Schluchtteiles, an der Kante des Gehänges zur Zschopau errichtete ein
Frankenberger Baumeister in den 1930er Jahren sein Domizil. Der dazugehörige
Swimmingpool wird mit Wasser eines kleinen Baches gespeist. Dieser hat sein
Quellgebiet oberhalb, im bereits verfüllten Teil der Schlucht und fließt
durch eine Stollnanlage ab. Das Mundloch des Stollns ist mit Müll verkippt,
auch ist die Lage nicht genau bestimmbar. Jedoch ist ab dem Mundloch der
Bach verrohrt worden. In den Bergakten wird ein Stolln erwähnt, der
unterhalb der Sachsenburg, auf Merzdorfer Fluren liegt. Auch verschwand ein
Bach in einer Pinge und trat zum Mundloch eines schon vorhandenen Stolln
wieder aus. Hier ist wohl mit sehr großer Sicherheit diese Stollnanlage
gemeint. Die in den Protokollen gemachten Angaben des Berggeschworenen
Christian Täuscher treffen auf die heutige Situation weitestgehend zu.
|
|
|
Zum 10. Oktober des Jahres 1736
wird einem Johann Christian Hartenbacher ein Erbstolln unter dem Namen „Maria
Josepha Erbstolln“ verliehen. Dieser war schon vorhanden und wurde mit zwei
Bergknechten und einem Grubenjunge aufgewältigt. Bei den Arbeiten bereitete
ebenfalls ein Bach, der in einer Pinge verschwand und zum Mundloch des Stolln
austrat, erhebliche Probleme. Nach 18 Lachtern erreichte man den Ortsstoß. Der
Gang soll eine Spanne mächtig gewesen sein und etwas Kupfererz führen. In der
Nähe des Stolln lag ein Pingen- und Haldenfeld, dessen Gänge eine südliche
Streichrichtung (flache und stehende Gänge) aufwiesen. Der Grubenbetrieb ist
mit großer Sicherheit bald darauf wieder eingestellt worden, da sich keine
weiteren Berichte in den Bergakten dazu finden. Vermutlich befand sich dieser
Stolln im Düstergrund. Auch hier gibt es einen Bach, der vor seiner Verrohrung
durch ein Pingen- und Haldenfeld floss!
|
|
|
|

|
Die Karte zeigt die Lage und
Ausdehnung des ehemaligen Bergbaugebietes zwischen Merzdorf und Biensdorf.
Umfangreiche bergbauliche Befunde sind nur im violett dargestellten Bereich
bei Biensdorf vorhanden. Im rot eingegrenzten Gebiet ist zwischen 1740 –
1850 die Renaturierung für landwirtschaftliche Zwecke durchgeführt worden.
Hier sind Übertage keine sichtbaren Befunde vorhanden.
Diese Karte können Sie mit
einem Mausklick vergrößern.
|
|
Dieses Pingen- und
Haldenfeld setzte sich im Bereich des Gehänges zur Zschopau auf einer
Breite von etwa 200m - 400m bis Biensdorf fort. Bei den
Untersuchungsarbeiten von Mitgliedern der damaligen
Arbeitsgemeinschaft Uralt Bergbau Merzdorf/Biensdorf um 1987 zeigten sich
Hinweise auf drei Stollnmundlöcher und drei verfüllten Schachtpingen. Zu
dieser Zeit fand sich hin und wieder Gangmaterial in den um
geackerten Flächen. Eine neben der Teufelsschlucht gelegene Geländevertiefung
wurde durch die AG - Mitglieder mit einer Schurfgrabung belegt. Hier
konnte das Mundloch eines Stolln freigelegt werden, der aber nach 9m durch
die ausgelaufene Verfüllmasse eines kleinen Schachtes verschüttet war.
Der Stolln war im Schnitt 130cm hoch und in der Sohle 80cm, in der Firste
60cm breit. Die Firste des Stollns ist leicht gerundet. Eine zeitliche
Einordnung ist wegen fehlender Befunde nicht möglich. Außerdem ist in
dem zugänglichen Bereich keine Gangstruktur erkennbar.
|
Bei einem „unglücklichen
Aufwältigungsversuch“ im Dezember 2000 erhielt der Stolln von
Bergbaufreunden den Namen „St. Bärbel“, einer nicht näher genannten
lieben Person gewidmet!
|
|
Auf der Feldkante oberhalb
des Stolln liegt der kleine Tagesschacht. Er ist an der abgerutschten Massesäule
und der Einzäunung erkennbar. Etwa 60m weiter in Streichrichtung des Stolln
muss ein weiterer Schacht liegen. Auf dem Feld war nach dem umackern ein
Fleck von 5m - 7m im Durchmesser von veränderter Bodenbeschaffenheit
sichtbar. Die Stelle ist dunkelgrau und mit fein zerkleinerten
Haldenmaterial durchsetzt. Heute, nach fast 20 Jahren ist sie kaum noch
auffindbar.
|
|
|
|
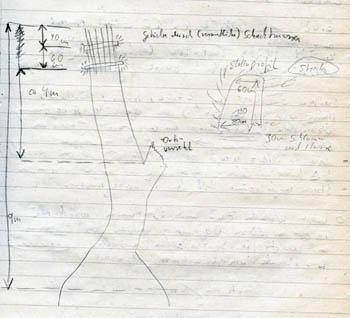
|
Skizze aus dem Feldbuch eines
Vereinsmitgliedes. Dargestellt die Maße des befahrbaren Stollnteiles mit
dem vermessenen Stollnprofil und den Angaben zur Aufwältigung des Bruches.
Die ganze Aktion misslang, weil bei starkem Tauwetter Unmengen von Wasser
durch den Bruch sowie die Schachtröhre hinab schossen und das Arbeiten im
mehr als Knie hohem Wasser unmöglich machten! Bilddokumente gibt es von diesem Einsatz leider nicht.
|
|
|
Beim Anlegen eines
Wanderweges 1987 entdeckten die AG - Mitglieder eine schräg am Gehänge
aufgeschüttete Halde nicht unbedeutender Größe. Allerdings konnten
trotz mehrerer Schürfversuche nicht das dazugehörige Stollnmundloch
lokalisiert werden. Noch heute, aber stark verwachsen ist die
Haldenstruktur erkennbar. Am Anfang des heute nicht mehr vorhandenen
Wanderweges, neben der vorletzten Linkskurve der Ortsverbindungsstraße
von Merzdorf nach Biensdorf, in der untersten Ecke des Feldes, oberhalb
des sogenannten Aquariums, liegt eine weitere verfüllte Schachtpinge mit
ähnlichen Material wie bei der vorher beschriebenen. Auch diese ist heute
fast nicht mehr im um geackerten Feld zusehen. Die unterste Ecke des
Feldes benutzte früher die LPG zur Entsorgung von Feldsteinen. Wegen der
starken Überschüttung nahmen die AG - Mitglieder von einer Suche nach
dem zugehörigen Stollnmundloch abstand und entschieden sich für die oben
beschriebene Stelle.
|
|
|
|
Grubenfelder um
Merzdorf:
1. Im Düstergrund bei Merzdorf sind noch Pingen und Halden sichtbar.
Oberhalb des bewaldeten Teiles liegt die Pinge eines
Untersuchungsschachtes der SAG Wismut von 1950.
2. Lage eines Schachtes und Stollnmundloch. Diese Spuren sind durch starke
Verkippung kaum wahrnehmbar! Hier befand sich die Stellfläche für die
Fahrzeuge der AG – Mitglieder und der Wanderpfad begann auch hier.
3. Lage eines noch sichtbaren Stollnmundloches und zugehörigen Schacht. Der
Gangzug war im geackerten Feld Ende der 1980er Jahre noch gut zu
verfolgen.
4. In der Wiese sichtbare Grabenvertiefung von (Kunstgraben nach Biensdorf?)
etwa 2 - 3 m Breite und Reste einer Wehrbefestigung am Ufer nach dem
Hochwasser 2002 gut sichtbar!
5. Teilweise als Müllkippe genutztes Tal, auch „Tiefer Grund“ genannt.
Dabei ist ein Stollnmundloch und weitere bergbauliche Spuren verschüttet
worden. Das Stollnmundloch ist verrohrt und führt viel Wasser in einem
Graben bis zu dem Tümpel am Wehr.
6. Dieser Bereich wird in einer „Chronik“ als „Kramrich“ bezeichnet.
Dabei soll es sich um einen Marktflecken aus der Bergbauzeit handeln.
Belege dafür gibt es nicht!
|
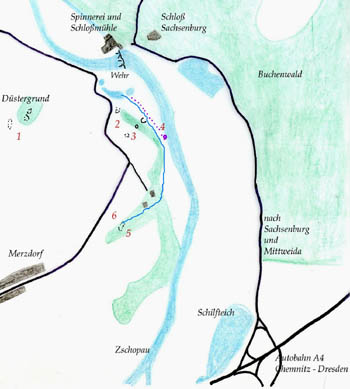
Diese Karte können Sie mit
einem Mausklick vergrößern. |
|
Unterhalb des eben
beschriebenen Grubenfeldes, in der Talaue der Zschopau, ist in der Wiese
noch der Verlauf eines Kunstgrabens zu sehen. Er versorgte nicht die
Merzdorfer Gruben mit Wasser, sondern den Biensdorfer Bergbau. Der Graben
fasste sein Wasser aus der Zschopau auf Höhe der Teufelsschlucht. Nach dem
Hochwasser 2002 war am Ufer eine Befestigung zu erkennen, die zu einem Wehr
oder Wasserteiler gehört haben könnte. Auf der Wiese ist der Graben nur
schwer als leichte Vertiefung erkennbar. Doch unterhalb des Gehänges führt
der Graben noch Wasser und ist recht gut zusehen. Ob es sich hier nun um den
originalen Verlauf handelt, oder dieser Abschnitt durch die Landwirtschaft
zur Entwässerung der Aue umgelegt wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Im
Gelände lässt sich der Graben bis zum sogenannten Aquarium am Berggehänge
entlang verfolgen. Dann ist bis Biensdorf im Gelände nichts mehr zu sehen,
höchstens noch erahnbar.
|
Der Graben ist auch 1770
auf einem Grubenriss von C. F. von Freiesleben dargestellt. Schon zu
dieser Zeit ist der Kunstgraben nur noch in Fragmenten vorhanden. Jedoch
berichtet Freiesleben von einem alten Wehr in der Zschopau, das auf dem Riss
nicht verzeichnet ist. Es ist anzunehmen, daß hier auch Vermutungen mit
eingeflossen sind. Freiesleben zeichnete den Grabenverlauf so, wie er zur
damaligen Zeit vorhanden war. Er endete an einer Pinge am Rande des
Biensdorfer Pingen- und Haldenfeldes neben dem Vorwerk. Weitere
Informationen zu dieser technischen Einrichtung konnte auch Freiesleben wohl
nicht mehr in Erfahrung bringen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|